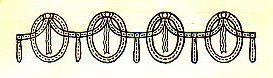Briefwechsel
zwischen Schiller und Goethe

Band I
(Leere Seite)
Briefwechsel zwischen
Schiller und Goethe
Mit Einführung von
Houston Stewart Chamberlain
Erster Band

Verlegt bei Eugen
Diederichs Jena 1905
Die
Vignette des Titels — der genius der Unsterblichkeit — stammt aus einem
Relief vom Sockel der Ehrensäule Antonins und ist dem Werke von A.
Hirt: „Bilderbuch für Mythologie“ usw., 2. Heft Tafel XVI
entnommen (Berlin 1805). Der Schmuck des Buches ist von E. R.
Weiß gezeichnet.
Zur Einführung
Seinen Briefwechsel mit Schiller gab Goethe in den
Jahren 1828 und 1829 heraus. Von dem Tage des Erscheinens an galt diese
Veröffentlichung als ein wichtigstes Denkmal in der Geschichte der
deutschen Literatur. Goethe selber schreibt darüber (Brief an
Zelter vom 30. 10. 1824): „Es wird eine große Gabe sein, die den
Deutschen, ja ich darf wohl sagen den Menschen geboten wird.“ Für
uns Heutige bleibt also nichts zu entdecken: wir können uns nur
dem Urteile der früheren Geschlechter anschließen. Doch
läßt sich eines nicht leugnen: der Zeiten Lauf ändert
die Perspektive, in welcher Erscheinungen von bleibender Bedeutung
erblickt werden, und so wird es immer von neuem nötig, oder
wenigstens nützlich, sich genau zu überlegen, was die
Gegenwart an ihnen besitzt, wie sie diesen Besitz einschätzt, wie
sie ihn deutet und verwertet. Nichts weiter als dies bezwecken folgende
einleitende Zeilen.
Allerdings kann keiner behaupten: ich bin die
Gegenwart; ein jeder aber trägt das Gepräge seiner Zeit; mag
er noch so individuell fühlen und reden, er ist doch einer unter
vielen, und viele sind es, die in dem einen zu Worte kommen. Wäre
das nicht der Fall, kein Vernünftiger würde es wagen, einem
Werke wie dem vorliegenden eine Einleitung voranzuschicken.
II Zur
Einführung
Wie hat nicht die Wertschätzung Schiller's und die Goethe's im
Laufe der hundert Jahre gewechselt, die uns heute von Schiller's Tode
trennen! Dies im einzelnen zu verfolgen, wäre keine
herzerquickende Beschäftigung; denn zur üblichen Verkennung
und Verballhornung des Genies tritt hier die eigentümliche und
perverse Neigung, einen der beiden gegen den andern auszuspielen. Dies
hat sehr früh begonnen. Schon 1825 klagt Goethe: „Nun streitet
sich das Publikum seit zwanzig Jahren, wer größer sei,
Schiller oder ich; und sie sollten sich freuen, daß überall
ein paar Kerle da sind, worüber sie streiten können“
(Eckermann 12. 5. 1825). Wohl hat es deutsche Gelehrte gegeben,
Gelehrte von Ruf (hier wenn irgendwo darf man sagen: nomina sunt odiosa) die dem
Nachweis, sowohl Goethe wie Schiller seien talentlos gewesen, dicke
Bücher gewidmet haben; doch blieb eine derartige Urteilslosigkeit
immerhin vereinzelt und ziemlich wirkungslos; verderblich dagegen war
und ist die allgemeine Neigung, Goethe auf Kosten Schiller's, oder
umgekehrt Schiller auf Kosten Goethe's in den Himmel zu erheben. Ich
spreche gewiß im Namen der Gegenwart, wenn ich sage: diesem
Unwesen sind wir entschlossen ein Ende zu machen; wir wollen nicht zu
wählen haben zwischen Schiller und Goethe, sondern wir wollen uns
beide anzueignen Suchen: Goethe u n d Schiller. Uns
ahnt schon deutlich: wer nicht beide besitzt, besitzt keinen von
beiden. „Einer ist ohne den andern nicht zu verstehen“, schreibt Goethe
von sich und Schiller (Brief an Boisserée vom 29. 9. 1826). Wer
da wählt, bewegt sich ganz an der Oberfläche; er ist das
willenlose Werkzeug gewisser Sympathien und Antipathien; die Nerven,
die Epidermis, die allgemeine phy-
III Zur
Einführung
sische
Beanlagung entscheiden, nicht das zugleich unbestechliche und
generöse Urteil des freien, sich selbst beherrschenden Verstandes.
Wo gäbe es ein Verstehen, wenn nicht der Empfangende dem Gebenden
auf halbem Wege entgegenkommt? Was wäre ein passives, rein
leidendes Verstehen? Zu b e m ü h e n haben wir
uns, wollen wir höchsten Phänomenen der Geisteswelt auch nur
einigermaßen gerecht werden; das zu tun, ist unsere Pflicht; das
bloße Gefallen hat nur für trivialere Dinge Geltung. Dieser
Schiller, für den die einen mit einem geringschätzenden
Seitenblick auf Goethe schwärmen, dieser Goethe, den die
Schillerverächter hochpreisen: das ist ja gar nicht der wahre
Schiller und der wahre Goethe; vielmehr sind es Truggebilde,
bloße Schemen für gewisse allgemeine Richtungen, Worte,
nicht Gestalten. Goethe und Schiller waren beide weit
größer, als eine Überlieferung sie macht, in der alles
Lebensblut zu harter Kruste gerinnt und zusammenschrumpft; an allen
Seiten brachen sie hinaus über die Linien und Ecken des
Gewohnheitsmäßigen, leicht Verständlichen. Darum aber
ist es schwer, sie zu kennen, sehr schwer; mit ein bißchen
Sympathie und Antipathie kommt man da nicht weit; es erfordert heiligen
Ernst, es erfordert harte Arbeit, es erfordert jahrelanges liebevolles
Versenken. Goethe ist wie die Natur: in ihm verschmelzen alle
Widersprüche zu organischer Einheit, täglich kann man an ihm
Neues entdecken, er ist nicht auszukennen, er sprengt jeden
begrifflichen Ausdruck; wie ein vollendetes Kunstwerk ist Schiller: aus
der machtvoll gedrungenen Einheitlichkeit in Gestalt und Ausdruck
schießen die Strahlen nach allen Seiten hin; wer nur die
landläufige Idealgestalt des dithyrambischen Dichters kennt,
IV Zur
Einführung
wird
viele Überraschungen erleben, wenn er den
abstrakt-philosophischen, den klug-praktischen, den
überlegt-diplomatischen Schiller entdeckt; je länger man
diese Erscheinung betrachtet, um so unerschöpflicher — wie ein
Werk der Kunst — dünkt einen ihre Bedeutung. Wenn auf irgend
etwas, dann wahrlich hat auf Schiller und auf Goethe das
vielangeführte Wort Anwendung:
Was du
ererbt von deinen Vätern hast,
E r w i r b es, um es zu besitzen.
Solche Erkenntnisse saugt man nicht mit der
Muttermilch ein, und kein Wahngedanke ist hohler als der, es
genüge, ein Deutscher zu sein, um Goethe und Schiller gleichsam
sympathetisch zu verstehen. Haben sie sich doch selber gegenseitig im
Anfang nicht verstanden, sondern dieses Verständnis erst im Laufe
der Jahre erworben.
In dem Briefwechsel besitzen wir nun, wenn auch
nicht ein ganzes, lückenloses Zeugnis, so doch ein wichtigstes
Dokument über diese gegenseitige Verständigung, über
dieses gegenseitige Eindringen eines jeden der beiden in die Eigenart
des anderen. Kein bisheriger Forscher führt so tief in die
Erkenntnis der Eigenart Goethe's ein, wie Schiller. Man lese nur seinen
Brief an Goethe vom 23.
August 1794! der Brief, von dem Goethe sagt:
„Sie ziehen in ihm mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner
Existenz.“ Wie immer, so auch hier ist Goethe schwerer zu verwerten,
weil er weniger logisch-didaktisch zu Werke geht; doch sicher ist,
daß er, mehr als irgend ein anderer Sterblicher, das ganze Wesen
Schiller's erfaßt, umfaßt und innig bewundert hat.
Er
glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend,
Unendlich Licht mit seinem Licht
verbindend.
V Zur
Einführung
Jeder der beiden drang aber von einer anderen Seite in das
Verständnis des Freundes ein. Erst die genauere Einsicht in die
dichterische und überhaupt in die schöpferische Reingewalt
Goethe's hat Schiller gelehrt, den M e n s c h e n
Goethe — der ihm anfangs nicht durchwegs sympathisch gewesen war — auf
seinen Wert zu schätzen; erst die Berührung mit dem Menschen
Schiller, die Erfahrung des erhabenen Zaubers, den sein innerstes
Geistesleben auf alle ausübte, die fähig waren, ihn zu
verstehen, erst dieses rein Persönliche eröffnete Goethen das
Verständnis für die D i c h t u n g e n
seines Freundes, deren Art so weit von der seinen abwich, daß sie
im ersten Augenblick fast abstoßend auf ihn gewirkt hatten. So
stehen sich die beiden antithetisch gegenüber. Darum — sobald sie
sich klar erblickt haben — wird jeder dem andern zuerst der
interessanteste Gegenstand der Welt, später der
geschätzteste, bewundertste Freund. „Geliebt“ wäre vielleicht
nicht der richtige Ausdruck; es handelt sich um mehr und um weniger als
Liebe; gerade daß sie infolge ihres ganzen Wesens einander immer
in einer gewissen Entfernung gegenüberstanden, verleiht der
Freundschaft zwischen Goethe und Schiller einen unvergleichlichen Zug
der Würde und macht zugleich, daß jeder den anderen wenn
nicht lückenlos, so doch schattenlos übersieht.
Aus diesen verschiedenen Erwägungen ergibt sich
der wahre Wert des Briefwechsels für uns alle: nicht nur
ergänzt er in köstlicher Weise, was wir sonst über
Schiller und über Goethe — über ihr Leben und über ihre
Anschauungen — wissen, sondern wir lernen hier jeden der beiden
großen Männer an d e m a n d e r e n
erkennen, und gerade dies bedeutet für unsere Kultur als
ganzes sowie für die Kultur jedes einzelnen unter uns einen
unschätzbaren Gewinn.
VI Zur
Einführung
Das allmähliche Werden dieses einzigen Verhältnisses, der
Umschwung aus dem Gemisch von Anerkennung und Verkennung zu
Verständnis, Bewunderung und Freundschaft geht nun zum
großen Teile dem Briefwechsel voraus; es ist darum nötig,
will man ihn verstehen, zuerst über das Vorhergegangene richtige
und deutliche Vorstellungen zu besitzen. Nur dann kann es gelingen, den
Briefwechsel in dem angedeuteten Sinne, nicht als Geschichte und
Wissenschaft, sondern zur Bereicherung des eigenen Innern durch die
Teilnahme an lebendigen, halb verborgenen Seelenvorgängen in dem
Busen unsterblicher Männer zu verwerten.
Dazu will ich in aller Kürze einige leitende
Grundgedanken geben.
Am 7. September 1788 begegneten sich Goethe und
Schiller zum ersten Male.
In Weimar sah man dieser Begegnung mit einiger
Spannung entgegen; sie geschah nicht unerwartet, ebensowenig geschah
sie aus spontanem Antrieb, vielmehr war sie von anderen Personen
eingeleitet und bewerkstelligt; darum stand sie unter einem
ungünstigen Sterne. Zwei Männer, die auf einsamer Höhe
sich sofort erkannt hätten, mußten einander auf dem Boden
der anständigen Mittelmäßigkeit entgegentreten,
mußten mit Damen und Herren „konversieren“, mußten tun, als
wüßten sie nicht, daß diese überflüssigen
Dritten auf ihre Begegnung und auf den Eindruck, den ein jeder Dichter
vom anderen erhalten würde, voll Neugierde harrten; ein jeder
wußte sich beobachtet und wollte selber beobachten; es fehlte die
Un-
VII Zur
Einführung
befangenheit,
es fehlte die Größe. So fand sich denn ein jeder in seinen
vorgefaßten Meinungen und in den Vorurteilen seiner Umgebung
bestärkt, und beide standen sich nach der Begegnung ferner als
vorher.
Um hierüber Klarheit zu gewinnen, wollen wir
uns fragen, in welcher allgemeinen Geistesverfassung sie an diesem 7.
September 1788 einander entgegengetreten sind; jedenfalls war sie auf
beiden Seiten eine ganz verschiedene.
Schiller ist am 10. November 1759, Goethe am 28.
August 1749 geboren; Schiller war also zehn Jahre jünger als
Goethe; zur Zeit als die hinreißenden Jugendwerke
Goethe's, G ö t z v o n B e r
l i c h i n g e n (1773) und W e r t h e
r s L e i d e n (1774) erschienen,
war Schiller noch ein Knabe; diese Dichtungen gehörten zu seinen
ersten großen Lebenseindrücken; er bewahrte sie im Herzen,
er lebte ihnen nach, er dichtete ihnen nach — wenn auch auf seine
Weise. Darum war es ein denkwürdiger Tag für ihn gewesen, als
am 14. Dezember 1779 der Herzog von Weimar die Karlsschule besuchte und
in seinem Gefolge Goethe erschien — der schon weltberühmte
Dichter, der Fürstenfreund, der Minister, der Vertraute aller
bedeutenden deutschen Männer. Mit welchem Herzklopfen mag Schiller
hinaufgeschaut haben zu dem Hochsitz, wo der Dichter inmitten der
Fürsten saß! Wohl sah Schiller schärfer als viele
Zeitgenossen und erblickte in Goethe nicht die „olympische Gestalt“,
die man schon damals dem weder großen noch frei sich bewegenden
Manne anzudichten beliebte: „Sein erster Anblick stimmte die hohe
Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und
schönen Figur beigebracht hatte“: so be-
VIII Zur
Einführung
kennt
Schiller später; „Goethe ist von mittlerer Größe,
trägt sich steif und geht auch so.“ Doch das klopfende Herz hatte
besser geurteilt als das prüfende Auge: Goethe war ihm ein
Höchstes geblieben. Inzwischen hatte nun Schiller seinen
stürmischen Lebensweg angetreten. Gewaltsam hatte er die Ketten
des hemmenden Zwanges zerrissen, kühn jeder konventionellen
Lüge den Krieg erklärt, heldenmütig der Not getrotzt.
Zehn Jahre machten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine
lange Zeit aus; zehn Jahre später als Goethe geboren, geriet
Schiller gerade in den empfänglichsten Jugendjahren und noch ohne
jeden Ballast an Lebens- und Menschenerfahrung in den brausenden Strom
der heraufziehenden Revolutionsideen; wogegen Goethe damals schon
Staatsmann war, für wichtige Fürsten- und Landesinteressen
die Verantwortung trug und alle diese Bewegungen darum aus einem
anderen Gesichtswinkel erblicken mußte. Später wurde es
immer klarer, und Goethe selber hat es ausgesprochen (Eckermann 4. 1.
1824), daß von den beiden Schiller seinem ganzen Wesen nach der
eigentliche Aristokrat war; doch vorderhand war es Schiller — nicht
Goethe —‚ der mit Werther rief: „Das ist eine Närrin, die sich auf
das bißchen Adel Wunderstreiche einbildet!“ und mit Götz:
„Es lebe die Freiheit! Und wenn die uns überlebt, können wir
ruhig sterben.“ So dem Zeitgeist genau seinen Ausdruck verleihend,
hatte der jugendliche Schiller, mehr noch vielleicht als seinerzeit der
jugendliche Goethe, mit seinen Erstlingswerken — d i e R ä
u b e r, F i e s c o, K a b a l e u n
d L i e b e — das ganze deutsche Volk aufgerüttelt.
Werther war ein Buch, ein Buch, das man unter dem Baume oder hinter dem
Ofen
IX Zur
Einführung
unter
Tränen der Wehmut einsam las, auch Götz wurde erst viel
später (1804) für die Bühne eingerichtet und war also
damals ebenfalls nur ein stummes Buch; Schiller dagegen schleuderte
seine Feuerreden von der Bühne herab in alle Herzen und
entzündete damit Begeisterung — oder aber deren ebenso
emportragende Ergänzung: Haß. Und das alles geschah zu einer
Zeit, wo Goethe, von
Staatsgeschäften und von dem Beginne seines unergründlich
tiefen, fünfzigjährigen Nachsinnens über die
Phänomene der sichtbaren Natur in Anspruch genommen, das Dichten
in größeren Formen zeitweilig fast aufgegeben hatte, um es
dann — mit Iphigenie und Tasso — auf einem viel höherer Niveau,
jenseits aller Zeitströmungen, jenseits auch aller
Möglichkeit
großer populärer Wirkungen wieder aufzunehmen. So war denn
Goethe — im Bewußtsein der Gebildeten — aus seiner führenden
Stellung als erfolchreichster, zu den größten Hoffnungen
berechtigender Poet Deutschlands gewichen, und Schiller hatte sie
eingenommen. In demselben Maße war natürlich Schiller's
Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein gewachsen; er hatte seine
Kräfte erprobt; er kannte sich; er wußte, daß er wert
war, von Goethe gesucht und gekannt zu werden. Ein Jahr vor der ersten
Begegnung mit Goethe schreibt Schiller an seinen Freund Ferdinand
Huber: „...ich erkenne meine Armut, aber meinen Geist schlage ich
höher an, als bisher geschehen war ... Mich selbst zu
würdigen, habe ich den Eindruck müssen kennen lernen, den
mein Genius auf den Geist mehrerer entschieden großer Menschen
macht. Da ich diesen nun kenne und den Vereinigungspunkt ihrer
verschiedenen Meinungen von mir ausfindig gemacht habe, so fehlt meinem
Urteile von mir
X Zur
Einführung
selbst
nichts mehr. Um nun zu werden was ich soll und kann, werde ich besser
von mir denken lernen und aufhören, mich in meiner eigenen
Vorstellungsart zu erniedrigen.“ Dies bedingte aber bei einem Mann von
Schiller's Größe keine geringere Verehrung für Goethe.
Im Gegenteil, es hat vielleicht eine Zeit gegeben — gerade die Zeit um
die erste Begegnung herum —‚ wo Schiller möglicherweise der
einzige Mensch war, der Goethe's Überlegenheit — gerade als
Dichter — über ihn selbst deutlich empfand. Schiller war sehr
schnell gereift; außerdem war er von Hause aus ein exquisit
kritisch-analytischer Geist; er urteilte darum scharf und richtig; er
kannte sich, er kannte die anderen. Aber — auch dies sei zum Schlusse
gleich hier hinzugefügt — er kannte Goethe nur nach seinen damals
veröffentlichten Werken, die Hälfte seines Wesens blieb ihm
also — wie allen — noch völlig verschlossen; und von dem Menschen
Goethe wußte er nur, was er von der einen kurzen Phase (Weimar
1775 bis 1786) hörte, aus dem Munde von Menschen hörte, die
alle — mit einziger Ausnahme Herder's — völlig unfähig waren,
einen Goethe in seinem Wesen zu beurteilen. Wie Herder urteilte,
ersieht man aus den wundervollen Worten in Schiller's Brief an
Körner vom 12. 8. 1787: „Herder gibt ihm einen klaren, universalen
Verstand, das wahrste und innigste Gefühl, die größte
Reinheit des Herzens! Alles, was er ist, ist er ganz, und er kann, wie
Julius Cäsar, vieles zugleich sein. Nach Herder's Behauptung ist
er rein von allem Intriguengeist, er hat wissentlich noch niemand
verfolgt, noch keines andern Glück untergraben. Er liebt in allen
Dingen Helle und Klarheit, selbst im kleinen seiner politischen
XI Zur
Einführung
Geschäfte,
und mit eben diesem Eifer haßt er Mystik, Geschraubtheit,
Verworrenheit ... Ihm ist er ein allumfassender Geist.“ Schiller traut
aber dem Urteil Herder's nicht, und sagt immer: Herder g i
b t ihm Verstand ... Herder w i l l ihn
bewundert wissen, usw. War also Schiller's Wertschätzung Goethe's
eine hohe und aufrichtige, so führte ihn doch — wie das
häufig geschieht — gerade die Schärfe seines Urteils in
mancher Beziehung bedenklich irre, was aus seinem Briefwechsel mit
Körner leicht zu belegen wäre.
So trat Schiller Goethe entgegen; wie nun sah es in
Goethe's Herzen aus?
Diese Frage ist weit schwerer zu beantworten, weil
bei Goethe Charakter und Intellekt verwickelter — oder wie Goethe sich
gern ausdrückt „verschränkter“ — angelegt sind als bei
Schiller. Goethe gleicht, wie oben gesagt, der Natur: das scheinbar
logisch Widersprechende ist bei ihm zu einer organischen Einheit
verknüpft. Darum gehört zum Verständnis Goethe's mehr,
als die bloße logische Rede geben kann, es gehört dazu ein
Erschauen, es gehört ein Etwas, was er selber als Wirkung der
Musik schildert: daß sie „die geballte Faust freundlich flach
läßt“. Schiller reißt uns mit sich hin, wir mögen
wollen oder nicht, Goethe erfordert Hingabe. Nicht nur physisch — in
seinen heroisch getragenen Leiden — war Schiller's Zustand der des
Kampfes, auch geistig ist sein Wesen die Ekstase, die Dithyrambe, der
gewaltsame Kampf der Seele gegen die Natur; er ist ein Held, er ist ein
Gigant, der Götter stürzt und an ihrer Stelle neue
inthronisiert. Bei Goethe ist dagegen aller Kampf nach innen verlegt;
wie in den Eingeweiden unserer Mutter Erde bleibt das
XII Zur
Einführung
Toben
der widerstreitenden Elemente dem Auge unsichtbar, dem Ohre
unhörbar, und nur selten mahnt ein vulkanartiger Ausbruch der
Leidenschaft oder eine plötzliche Erkrankung, die den gesunden
Mann in wenigen Stunden bis an die Tore des Todes führt, —
Schon
rast's und reißt in meiner Brust gewaltsam,
Wo Tod und Leben grausend sich
bekämpfen
— an das große Werk des Gärens und Reifens, das ungesehen im
Innern vor sich geht. Ruhe, Harmonie, Versöhnung zwischen den
feindlichen Gewalten — auch zwischen Mensch und Natur, zwischen Ideal
und Instinkt, zwischen Sollen und Wollen, zwischen dem Traum und dem
Schicksal — das ist Goethe's Ziel, das ist, was er in sich selber
erleben, verwirklichen will. Goethe ist sich aber dieser seiner
Eigenart weit später als Schiller sich der seinen bewußt
geworden. Von Schiller berichtet Goethe: „Es war nicht seine Sache, mit
einer gewissen Bewußtlosigkeit und gleichsam
instinktmäßig zu verfahren, vielmehr mußte er
über jedes, was er tat, reflektieren“ (Eckermann 14. 11. 1823);
hingegen gehörte eine breite Grundlage des unbewußten Lebens
und Schaffens dazu, um das zu werden, was Goethen bestimmt war. Goethe
mußte sich gewissermaßen selber als unbewußte
Naturerscheinung erblicken, ehe er sein Selbst begreifen konnte.
Über diesen Vorgang des allmählichen Sichbewußtwerdens
Goethe's und über die Lebenskrisis, die er bedingte, ist hier
nicht der Ort, näher zu berichten; das würde viel zu weit
führen. Es genüge zu sagen, daß der Aufenthalt in
Italien, 1786—1788, den Höhepunkt der Krisis darstellt; hier folgt
auf die größte Unklarheit über sich die endgültige
Einkehr in sich, der Entschluß, ein neues,
XIII Zur
Einführung
zielbewußtes
Leben zu beginnen. Der Goethe, der aus Italien heimkehrt, ist ein
anderer Mann als der Goethe, der zwanzig Monate vorher
hingeflüchtet war — nicht, weil er innerlich ein anderer geworden
ist, sondern weil er jetzt die wunderbarste aller Erscheinungen, sein
eigenes Selbst, erblickt, erkannt, begriffen hat, und nunmehr
entschlossen ist, der lückenlosen, überzeugenden
Ausgestaltung dieses Phänomens sich ungeteilt zu widmen. Wohl
blieb Goethen auch fernerhin manches an seinem eigenen Wesen
geheimnisvoll, ja geradezu unklar; an Schiller schreibt er: „Sie werden
bei näherer Bekanntschaft eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir
entdecken, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich
ihrer gleich sehr deutlich bewußt bin“ (27. 8. 1794); doch klar
und unerschütterlich war hinfürder der Beschluß des
Willens: der reinen Ausbildung der eigenen Persönlichkeit zu
leben. Niemals in der Geschichte der Menschheit war das Objekt so ganz
Subjekt, niemals hat ein Subjekt sich so rein objektiv erfaßt.
Und nun, als fast vierzigjähriger Mann, der
endgültig aus Wolken und Sturm in die errungene Klarheit des Tages
getreten ist, vor sich ein unendlich ferner, aber in ruhiger Fahrt —
wenn auch vielleicht erst nach Jahrhunderten (was bedeutet für
einen solchen Mann die Zeit?) .... vor sich ein unendlich ferner, aber
sicher dereinst zu erreichender Horizont, — jetzt, wo er nur eines
will: Ruhe um sich und in sich, die „Kindesruh“ (wie es im Faust
heißt) und Gelassenheit und Impassibilität der Natur .....
jetzt stört ihn aus jedem Munde der Name „Friedrich Schiller“ auf,
er vernimmt von den unerhörten Erfolgen, er findet beim
Wiederbetreten des deutschen Bodens alle Welt in die Betrachtung des
neuen
XIV Zur
Einführung
Sternes
an dem Himmel deutscher Sprache, Poesie und Bühnendichtung
schwärmerisch versenkt! Selbst wenn man einzig das Formelle in
Betracht zieht, wie konnte der Mann, der soeben I p h i g e
n i e und T a s s o gedichtet hatte, ohne
Widerwillen die R ä u b e r lesen? „Schiller's
Räuber widerten mich äußerst an“, gesteht er auch
buchstäblich. Und das betrifft erst die Oberfläche. Die ganze
Geistesrichtung war es, die Goethe notwendig abstoßen
mußte: das Gewaltsame, das Politische, das Demagogische, das
phrasenreich Deklamatorische, das logisch Didaktische. Alles und jedes
war den Idealen Goethe's — so mußte es scheinen — direkt
entgegengesetzt. Und war Goethe auch wenig oder fast garnicht eitel, um
so größer war sein Stolz, sein sicheres Bewußtsein des
eigenen Wertes; nicht mit Unrecht hatte er glauben können, die
Führerschaft in dem Werdegang der deutschen Literatur zu besitzen;
der Sturm und Drang sollte jetzt vorbei, überwunden, vergessen
sein, die neuen Wege waren schon ausgedacht und angebahnt ... Und
gerade in diesem Augenblick tritt der Neuling mit den
Prophetengebärden auf, reißt die Herrschaft an sich, gewinnt
über Nacht alle Herzen und vernichtet mit einem Schlage, was
Goethe aus reifer Überzeugung für die Kultur seines Volkes
geplant hatte: „Die reinsten Anschauungen suchte ich zu nähren und
mitzuteilen — und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor
eingeklemmt.“
Es läßt sich nicht in Abrede stellen, und
es darf auch nicht aus kleinlichen Beschönigungsrücksichten
geleugnet werden, daß Goethe am 7. September 1788 Schiller nicht
mit freundlichen Gefühlen entgegentrat. In seiner Brust herrschte
eine starke Voreingenommenheit.
XV Zur
Einführung
Und noch ein letztes muß zur völligen Klarlegung der
Situation gesagt werden.
Als Schiller und Goethe sich zum ersten Male
begegneten, waren beide schon reich an Welterfahrung; die
schützende, abwehrende Gebärde, die das unschuldige
Gemüt noch nicht kennt, der Weltmann aber nicht entbehren kann,
war darum bei beiden entwickelt, bei beiden aber verschieden. Der
Grundzug in Schiller's natürlichem Verhalten gegen andere war die
Großmut, bei Goethe dagegen war er die Naivität. Wird nun
der großmütige Mensch durch schlechte Erfahrungen gewitzigt,
so entwickelt sich bei ihm als Schutzgebärde — wenn er
genügend Seelengröße besitzt, um nicht
mißtrauisch zu werden — die V o r s i c h t,
der naive Mensch dagegen wird v e r s c h l o s s e n,
er mißtraut sich selber. Schiller war ein Diplomat
geworden und konnte sicher sein, sobald er nur aufpaßte, nie
betrogen zu werden; „Schiller hatte viel mehr Lebensklugheit als ich“,
bezeugt Goethe; Goethe dagegen hielt jeden aus seiner Intimität
fern, bis er ihn für ganz reinen Herzens erkannt hatte. So trat
denn Goethe verschlossen, Schiller vorsichtig dem künftigen
Freunde entgegen; keiner gab sich, wie er war; der
Großmütige war nicht großmütig, der Naive nicht
naiv; jeder verhüllte sein wahres Antlitz hinter der ihm eigenen
Schutzgebärde.
Auf diese erste Begegnung habe ich starken Nachdruck
legen zu sollen geglaubt, weil mir für die Ausgestaltung einer
Freundschaft nichts wichtiger erscheint als ein solcher erster
Eindruck. Dieser muß historisch genau und psychologisch richtig
aufgefaßt werden, sonst wird alles fernere unverstanden bleiben
oder — was noch schlimmer ist — falsch gedeutet werden.
XVI Zur
Einführung
Sagte ich vorhin: Goethe und Schiller hätten sich nach der
Begegnung noch ferner gestanden als vor ihr, so muß ich jetzt
ergänzend hinzufügen: sie erblickten sich aber trotzdem in
gewissen Beziehungen besser. Die tatsächliche Gegenwart einer
großen Persönlichkeit ruft in einer anderen
Persönlichkeit von Bedeutung auf alle Fälle einen
nachhaltigen Eindruck hervor. Wenige Wochen nach jenem Septembertage,
wenige Monate nach seinen ironischen Glossen über Herder's
Bewunderung schreibt Schiller (10. 12. 1788): „Goethe drückt
seinen Geist allen mächtig auf, die ihm nahe kommen“; und bald
nachher (25. 2. 1789): „Mit Goethe messe ich mich nicht ... Er hat weit
mehr Genie als ich ...“ Goethe freilich bleibt stumm, stumm nach
außen; doch ist an dem Eindruck, den er innerlich empfangen
hatte, nicht zu zweifeln; nicht allein sein schnelles und energisches
Eingreifen, um Schiller die Professur in Jena zu sichern, sondern in
weit höherem Maße noch zeugt die ganze spätere
Freundschaft dafür. Bei Goethe brauchte alles Zeit zum Reifen, —
auch die Freundschaft für Schiller.
Dazu kommt ein Wichtigeres, ein Entscheidendes. Ich
weiß, ich werde zunächst Anstoß und Mißverstand
erwecken, denn meine Behauptung widerspricht schnurstracks der
allgemeinen Annahme, doch wird man mir bei genauerem Besinnen Recht
geben: Goethe war damals für Schiller's Freundschaft n
o c h n i c h t r e i f. Schiller's
kurzes, schweres, von leidenschaftlicher Tat erfülltes Leben hatte
eine ganz andere Entwicklungsart bedingt als die Goethen vom Schicksal
vorgeschriebene; dem Kalender nach war er zehn Jahre jünger als
Goethe, was aber die innere Reife, was sozusagen das Lebensstadium
betrifft, so hatte der
XVII Zur
Einführung
jüngere
Mann den älteren bereits überholt, als sie sich das erste Mal
die Hand reichten. Goethe war soeben erst zur Besinnung über sich
selbst gelangt, Schiller hatte schon jede Falte seines Herzens
durchsucht und schaltete mit sich als ein noch nicht ganz vollendeter,
aber doch fast vollendeter Meister, — „meinem Urteil von mir selbst
fehlt nichts mehr“; Goethe mußte aus tausend Elementen eine
Weltanschauung aufrichten und war noch lange nicht damit fertig,
Schiller
Der
Sinnende, der alles durchgeprobt
war für das abstrakte Denken hoch begabt und urteilte bereits
sicher und ohne Wanken und mit systematischer Genauigkeit über die
meisten letzten Fragen; Goethen quälte gerade damals die
Vorstellung eines nahen Todes und das Bewußtsein, daß er
sich in so kurzer Zeit nicht würde vollenden können, Schiller
sah dem Tode ganz nahe in die Augen und hatte die Furcht
überwunden, er lebte gleichsam schon jenseits.
Er hatte
früh das strenge Wort gelesen,
Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut.
Wie stand auch moralisch — ich meine dies Wort durchaus nicht kleinlich
— aber wie stand ein Schiller einem Goethe moralisch gegenüber!
Schiller, der gerade in diesem Augenblick mit einem reinen,
zartsinnigen, hochgebildeten Mädchen aus vornehmer Familie,
fähig alles mit ihm zu teilen, was seine Seele im Innersten
bewegte, den heiligen Treuebund schloß, und Goethe, der aus den
Armen leichtfertiger italienischer Schönen kam und sich soeben ein
nettes, hübsches, aber ungebildetes und in ihren
Geschmacksrichtungen ziemlich gewöhnliches Mädchen als
„lieben Bettschatz“ (wie Frau Aja sich pittoresk ausdrückt)
XVIII Zur
Einführung
ins
Haus genommen hatte. Mußte nicht der Vergleich auf Goethe tief
wirken, auf Goethe, den eindruckszartesten aller Menschen? Kaum hatte
er die Krisis seines Lebens überwunden und sich resolut von allem
Bisherigen abgewendet, im Bewußtsein, hinfürder unverstanden
und einsam durch die Welt gehen zu müssen, da tritt der Mann ihm
entgegen, der einzig unter allen befähigt war, ihn zu verstehen.
Leicht ist es, der Menge entfliehen, schwer, sich vor dem Auge
verbergen, das bis auf den Grund des Herzens sieht. Der durchdringende,
viel gefürchtete Blick des stolzen, bewußten, sicher
urteilenden Schiller mußte auf Goethe zunächst wie eine
Verletzung wirken, wie eine Verletzung seines Geheimnisses...
So standen sich denn die beiden Männer nach der
Begegnung, wenn auch ferner, nichtsdestoweniger beziehungsreicher
gegenüber als vorher; der Same war gesäet worden; wohl lag er
verborgen im Schoße der Zukunft, doch ist dies eine
Lebensbedingung für alles, was groß und dauerhaft werden
soll. Natürlich haben wir bei den Beteiligten von dem, was
vorging, kein ausführliches Bewußtsein vorauszusetzen:
Goethe schloß sich äußerlich gegen Schiller, Schiller
innerlich gegen Goethe ab. „Öfters um Goethe zu sein, würde
mich unglücklich machen“, schreibt Schiller am 2. Februar 1789 an
Körner; und am 5. Februar schreibt er an Caroline von Beulwitz:
„Dieser Charakter gefällt mir nicht, ich würde mir ihn nicht
wünschen, und in der Nähe eines solchen Menschen wäre
mir nicht wohl.“ Doch kaum sind ihm diese Worte entschlüpft,
fügt der ahnungsreiche Mann hinzu: „Legen Sie dieses Urteil
beiseite; vielleicht entwickelt es uns die Zukunft, oder noch besser
wenn sie es widerlegt.“
XIX Zur
Einführung
Wir
aber, denen der ganze Verlauf der Beziehungen vor Augen liegt, wir
dürfen und müssen uns über das Verborgene, über
das, was in den Tiefen keimte und trieb, Rechenschaft geben, sonst
bleibt Verständnis für Seelenvorgänge ein leeres Wort.
Symptomatisch ist das Verhalten der beiden
Männer in den folgenden Jahren. Nie in seinem Leben war Goethe so
abgeschlossen und oftmals fast barsch wie in dieser Zeit. Seine einzige
Leidenschaft war das Studium der Natur; vieles Beste, was er auf diesem
Gebiete geleistet hat, stammt — als Anregung oder als Ausführung —
aus diesen Jahren. Der „Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu
erklären“ erschien 1790, der „Versuch über die Gestalt der
Tiere“ ist in demselben Jahre skizziert; zu gleicher Zeit beginnen die
Experimente über die Farben und führen schon 1792 zu der
grundlegenden Auseinandersetzung: „Der Versuch als Vermittler von
Objekt und Subjekt“. Gedichtet hat Goethe dagegen in dieser Zeit
erstaunlich wenig; unter dem wenigen aber eine Anzahl seiner
schwächsten Sachen: D e r G r o ß k
o p h t a, D e r B ü r g e r g e n e r a l,
D i e A u f g e r e g t e n usw.
Schiller's politische Tendenzdichtung hatte ihn abgestoßen, und
jetzt schrieb er selber politische und tendenziöse Dramen — aber
satirische, arm an Gehalt und Wirkung! Auch Schiller's poetische Ader
schien zu versiegen. Er ward Professor und widmete seine besten
Kräfte der Geschichtschreibung. Das Glück der Ehe und der
Familie, der Verkehr in einem großen Freundeskreise, die
vielfachen Arbeiten als Herausgeber der „Thalia“ erfüllten
zunächst seinen Geist und seine Zeit. In den Jahren der
Entfremdung von Goethe hat Schiller kein einziges Drama geschaffen,
überhaupt
XX Zur
Einführung
keine
Dichtungen von Belang mit Ausnahme des Lehrgedichts „Die
Künstler“. Während aber Goethe sich in die Natur versenkte,
versenkte sich Schiller in die Reflexion: aus dieser Zeit stammen
„Über Anmut und Würde“, „Über das Pathetische“,
„Über das Erhabene“, die „Briefe über die ästhetische
Erziehung des Menschen“ (erste Fassung), „Über den Grund des
Vergnügens an tragischen Gegenständen“, „Über die
tragische Kunst“, und noch manches dieser Art. Sobald dagegen die neue
Begegnung mit Goethe — die entscheidende des Jahres 1794 —
stattgefunden hatte, sobald Schiller sich fest verankert wußte in
dem Herzen des allbegreifenden und allgebenden Freundes, da begann die
neue, die große Epoche seines Schaffens: Wallenstein, Maria
Stuart, Die Jungfrau von Orleans, Die Braut von Messina, Wilhelm Tell,
Demetrius.
Zwischen 1788 und 1794 haben sich Schiller und
Goethe öfters gesehen oder geschrieben, doch nur kurz,
bedeutungslos, in rein geschäftlichen Angelegenheiten. Goethe war
äußerst zurückhaltend; sein Instinkt sagte ihm,
daß die Zeiten noch nicht reif seien; auch Schiller, der
ungestüme, der — wie wir gesehen haben — das, was kommen sollte
und mußte, deutlicher als Goethe vorahnte, drängte nicht.
Was groß und heilig ist, darf nicht begehrt werden; es muß
— wie die Religionen sagen — uns als Gnade zuteil werden; das vom
Willen selbstherrisch Ergriffene ist immer — und sei es nur
stellenweise — verunstaltet. Goethe und Schiller haben beide zu warten
gewußt.
Die Stunde der Gnade kam. Alle Welt kennt Goethe's
berühmte Erzählung von der Begegnung am 14. Juli 1794; ich
werde sie nicht abschreiben; wer sie etwa nicht
XXI Zur
Einführung
kennen
sollte, schlage den Bericht „Glückliches Ereignis“ nach. *)
Jetzt endlich hatten sich die beiden so getroffen,
wie es für sie einzig sich schickte: allein, in der Nacht, auf den
Höhen des menschlichen Denkens. Sofort offenbarte Goethe dem
Freunde eine neue Welt, eine Welt, die uns alle umgibt, die Schiller
aber — in abstraktes Sinnen, in ästhetische Meditationen, in
Geschichtsstudien, in Sittenprobleme versenkt — noch nie erblickt
hatte; Goethe öffnete ihm die Augen. Doch Schiller, der Denkgewaltige, hatte noch
mehr Augen für Goethe, als für das, was Goethe ihm zeigte,
die
Urpflanze, das Urtier, die Metamorphose der Organe, die Verwandtschaft
der Farben, usw. waren das alles doch Geschöpfe Goethe's, nicht
Phänomene der Natur. „D i e A n s c h a u
u n g I h r e s G e i s t e s — denn so
muß ich
den Totaleindruck Ihrer Ideen auf mich nennen“, schreibt kurz nach dem
denkwürdigen Abend Schiller an Goethe! Schiller als erster
entdeckte
das Geheimnis dieses wunderbaren Intellektes, der nichts erblicken
konnte, ohne es sofort schöpferisch zu gestalten. Goethe war
mitten in einem leidenschaftlichen Vortrag; da unterbricht ihn
Schiller: „das ist keine E r f a h r u n g, das ist
eine I d e e !“ Goethe, der
naive, stutzt, wird fast
—————
*) In vielen Ausgaben ist dieser Bericht in
die „Annalen“ eingeschoben, am Schlusse des Jahres 1794, in anderen
findet man ihn unter der Rubrik „Biographische Einzelnheiten“ oder auch
unter „Allgemeine Naturlehre“. Die Redaktionen entsprechen sich an den
verschiedenen Orten nicht überall genau. Belehrung über diese
durch Goethe selbst veranlaßte Unsicherheit oder
Vielfältigkeit der Einordnung findet man in der Weimarer Ausgabe,
1. Abt., 36. Bd., S. 437 ff.
XXII Zur
Einführung
ärgerlich;
nach und nach aber geht ihm auf, Schiller habe mit diesem einen Worte —
wie mit einem Blitzstrahl — bis in die tiefste Tiefe seines ihm selber
unbekannten Intellektes hineingeleuchtet. Er hatte geglaubt, Schiller
eine Welt zu zeigen: sich selber hatte er ihm in Wirklichkeit offenbart.
So ergänzte sich denn bei dieser ersten wahren
Begegnung das gegenseitige Geben und Nehmen in eigentümlicher
Weise; so blieb es auch in der Folge.
Goethe — die Welt Goethe's — ward nunmehr für
Schiller eine Art Element, ein Element, in dem er dichterisch
wiedergebar, was er sonst nur abstrakt erfaßt hatte, weswegen ihm
bisher gar manches unerkannt geblieben war. Um uns der Schillerschen
Denkweise anzunähern, können wir sagen: Goethe ward für
ihn ein Spiegel, ein Zauberspiegel. Man darf gewiß behaupten,
keine einzige der großen Bühnengestalten aus Schiller's zehn
letzten Lebensjahren wäre ohne Goethe's Gegenwart entstanden.
Nicht etwa, daß Goethe sie eingegeben hätte, nicht etwa,
daß sie nicht von Kopf bis zu Fuß Schiller's Geschöpfe
gewesen wären, aber in dem Verkehr mit Goethe gewann für
Schiller alles, was er sah und erdichtete, beziehungsreichere Umrisse.
Wenn er, der Denker, in ihm, dem Schauer, die Dinge erblickte, waren
sie für ihn durchsichtig. Seine poetischen Schöpfungen wurden
unausdenkbar, enigmatisch, lebenswahr. Von Goethe darf man nicht
behaupten, er sei ein „Seher“ gewesen, — denn dies bedeutet immer eine
Exazerbation des Nerven- und Hirnlebens, also das genaue Gegenteil
dessen, was für sein Wesen bezeichnend war; die seherische Gewalt
aber, die in Schiller's Werken aus dem Höhepunkte seines Schaffens
XXIII Zur
Einführung
Unvergleichliches
an menschlichen Gestalten schuf, sie hatte der Dichter an Goethe
gewonnen.
Insofern dürfen wir auch gewiß behaupten,
Schiller, der Dichter, habe mehr von Goethe gewonnen, als Goethe, der
Dichter, von Schiller. Wohl ist Goethe von Schiller zur Wiederaufnahme
seines dichterischen Schaffens angeeifert worden; außerdem
mußte die in jede einzelne Absicht genial eindringende,
freimütig-kritische Auffassung seiner Dichtungen durch Schiller —
wovon man in diesem Briefwechsel unschätzbare Beispiele findet —
viel Anregung und manche Belehrung verschaffen; doch berührt das
alles mehr die Oberfläche. In früherer Zeit hätte
Schiller's Einfluß für Goethe's Dichten leicht verderblich
werden können; jetzt war es ihm unzugänglich; und
während
Schiller alle seine Pläne Punkt für Punkt mit Goethen
durchsprach, verheimlichte Goethe die seinen so viel es anging; das
eine Beispiel genügt: Hermann und Dorothea war bei seiner
Vollendung für Schiller eine Überraschung. Wo Schiller
später in Werke Goethe's tätig eingriff, so z. B. bei der
Aufführung Egmont's, war es immer zum Schaden des Werkes. „Ich
hatte nur immer zu tun, daß ich feststand und seine wie meine
Sachen von solchen Einflüssen freihielt und schützte“, sagt
Goethe zu Eckermann (23. 3. 1829).
Dagegen hat Schiller auf die ganze Entwicklung, oder
vielmehr Entfaltung des Goetheschen Geistes einen geradezu
unermeßlichen Einfluß ausgeübt; erst durch Schiller
erreichte Goethe den höchsten Grad der Klarheit über sein
eigenes SeIbst. War Goethe für Schiller ein Spiegel, so war
Schiller für Goethe eine Leuchte. Zur lückenlosen Einsicht in
das Getriebe seines eigenen Geistes ist Goethe
XXIV Zur
Einführung
allerdings
nie gelangt; das war durch die Beschaffenheit dieses Geistes
ausgeschlossen; doch hat das Licht, das Schiller über den
Gegenstand warf, sehr viel zur philosophischen Vertiefung seiner ganzen
Auffassung der Natur, seiner Weltanschauung und seiner Lebensweisheit
beigetragen. Bisher hatte Goethe zwischen einem ziemlich seichten,
spinozistisch angehauchten, unklar
pantheistischen Mystizismus und einem gesunden, aber derben, naiven
Naturalismus hin- und hergeschwankt. Durch Schiller wurde er auf das
eigene Unbewußtsein, auf die Konfusion in seinem Denken
aufmerksam gemacht; gleich am ersten Abend — wir sahen es vorhin —
zeigte ihm Schiller, daß er nicht einmal zwischen einer aus der
empirischen Natur gewonnenen E r f a h r u n g und
einer im eigenen Innern entsprungenen I d e e zu
unterscheiden wisse; dann führte er ihn — so weit es gelingen
wollte — in die wahre Kritik der Erkenntnis ein, wie sie Plato
begründet und Immanuel Kant gerade in jenem Augenblick zur
vollendeten Klarheit entwickelt hatte. Doch die theoretische Belehrung
allein hätte gerade bei einem Goethe wenig oder nichts
genützt, wenn nicht die Erfahrung eines Genies, das in dieser
metaphysischen Welt lebte und aus ihr heraus Unvergängliches
schuf, mit unbewußter Notwendigkeit zu einer Gestaltung und
Umgestaltung seiner eigenen Anschauungen geführt hätte.
In Goethe hatte ein Schatz an Idealismus nicht nur
des Gemütes, sondern auch des Denkens sozusagen latent gelegen;
die vielen Interessen des mächtigen Verstandes und die ganze
praktische, vernünftige, fast spießbürgerliche Anlage
hatte, wenn nicht den Schatz verdeckt, so doch auf ihm gelastet. Nach
Überwindung des jugendlichen Über-
XXV Zur
Einführung
mutes
war Goethe's ganzes Bestreben darauf gerichtet gewesen, sich innerhalb
des Erreichbaren, Gegenwärtigen zu begrenzen, zu beschränken;
es war, als wolle er sich selber die Flügel binden. Schiller
deckte diese Selbsttäuschung auf. Denn in Wirklichkeit — wie
vorhin angedeutet — lag der Horizont, auf den Goethe zusteuerte,
unendlich fern; das gerade war es, was eine so gewaltige
Selbstbeherrschung erforderlich machte. Goethe gestaltet Zukunft. Und
so schreibt denn Schiller an Goethe: „Sie können niemals gehofft
haben, daß Ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde; aber
einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr wert als jeden
andern zu endigen.“ Goethe sieht es ein und antwortet: „Ich fühle
sehr lebhaft, daß mein Unternehmen das Maß
der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit
übersteigt...“ Das ist nunmehr bewußter Idealismus der
Gesinnung.
Hat also die Einwirkung Goethe's auf Schiller
namentlich in einer Erweiterung des Gesichtskreises und in einer
Schärfung des Blickes bestanden, so betätigt sich der
entsprechende Einfluß Schiller's auf Goethe in einer
Aufklärung der eigenen Seele; die dunklen Tiefen dieses
unergründlichen Geistes werden — wenigstens bis zu einem gewissen
Grade — aufgehellt. Und dies mußte notwendig auch auf sein
Dichten zurückwirken. „Von der ersten Annäherung an,“
schreibt Goethe über seine Freundschaft mit Schiller, „war es ein
unaufhaltsames Fortschreiten philosophischer Ausbildung und
ästhetischer Tätigkeit... Für mich war es ein neuer
Frühling, in welchem alles froh nebeneinander keimte und aus
aufgeschlossenen Samen und Zweigen hervorging.“ Ohne Schiller wäre
XXVI Zur
Einführung
der
zweite Teil des Faust nie gedichtet worden; nie hätte Goethe den
Vers geschrieben:
Den
lieb' ich, der Unmögliches begehrt.
Bald nach der entscheidenden Begegnung des Jahres
1794 beginnt der Briefwechsel.
Das eine möge der Leser wohl bedenken: dieser
Briefwechsel ist nur ein Bruchstück aus dem Verkehr zwischen
Schiller und Goethe. Das beste, was die beiden sich zu geben hatten,
gaben sie sich mündlich. So oft es zu ermöglichen war,
brachten sie Tage, manchmal auch Wochen zusammen zu, sei es in Jena,
sei es in Weimar; später (1799) zog Schiller ganz nach Weimar; die
Freunde trafen sich täglich auf der Bühne, fuhren zusammen
aus, schlossen sich in des einen oder des anderen Arbeitsstube ein; sie
hatten nicht nötig, einander Briefe zu schreiben. So sind denn
sehr viele Briefe — namentlich von seiten Goethe's — nur als kurze
Notizen zu benutzen, aus denen wir verfolgen können, welche
Gegenstände durchgesprochen worden waren oder werden sollten.
Nicht selten gleichen diese Mitteilungen Schattenbildern an der Wand
und reizen unsere Neugier, ohne daß uns etwas Wesenhaftes in den
Händen bliebe. Dennoch überspringe man keine Seite; denn
zwischen den Zeilen selbst der scheinbar inhaltslosen Briefe schlummern
— dem Unaufmerksamen verborgen — gute Geister, die dem Aufmerksamen gar
manches anzuvertrauen haben.
Ich halte es nicht für schicklich, da, wo
Goethe und wo Schiller reden, zu ihren Worten noch meine Betrachtungen
zu liefern. Den ehrenvollen Auftrag, zu diesem unvergänglichen
Werke eine Einleitung zu schreiben, konnte
XXVII Zur
Einführung
ich
nur als eine Veranlassung betrachten, den Leser von dem großen
kulturellen Wert dieses Briefwechsels zu überzeugen; das aber
nötigte mich, ihm dasjenige vorzuführen, was dem Briefwechsel
voranging und was ihn — als unsichtbare Atmosphäre — umgibt;
hingegen eine eingehende kritische Würdigung und ein fortlaufendes
Kommentar zwar manches Interessante bringen könnten, hier jedoch
schlecht am Platze wären.
Was unsere Zeit braucht, was unsere Zeit sucht, sind
freie, festgegründete Persönlichkeiten. Wir ersticken unter
Tatsachenüberfülle, und büßen dabei an Kraft und
Mut und Urteil ein. Auch darunter leiden wir schwer, daß eine
gewisse Art von nüchterner Durchschnittsbegabung dieser Last am
besten standhält und somit die führende Stellung im Leben an
sich reißt zum Nachteil edlerer Elemente. Schiller und Goethe
haben die Anfänge dieser Wandlung erlebt und haben beide
vorausgesehen, wohin sie notwendig führen mußte. Schiller
spricht von den „Schlachtopfern des Fleißes“ und sieht um sich
herum eine Zeit entstehen, in der „der tote Buchstabe den lebendigen
Verstand vertritt, und ein geübtes Gedächtnis sicherer als
Genie und Empfindung leitet“. Mahnend richtet er an das kommende
Jahrhundert die Frage: „Kann wohl der Mensch dazu bestimmt sein,
über irgend einem Zwecke sich selbst zu versäumen?“ Und weise
lehrt er uns einsehen: durch Verbreitung der Wissensfläche
„ergreifen“ wir zwar immer mehr, doch hängt das „Begreifen“ von
der „Kraft und Tiefe der Persönlichkeit“ und von der „Freiheit
ihrer Vernunft“ ab. Goethe anzuführen dürfte kaum nötig
sein. Ich schlage auf gut Glück die Briefe an Zelter auf und
höre, wie er klagt, die ganze Christenheit „verliert sich in
XXVIII Zur
Einführung
den
Minuten des grenzenlos Mannigfaltigen“, wie er es (1829) als „die
Tendenz der Zeit“ bezeichnet: „alles ins Schwache und Jämmerliche
herunterzuziehen“, und wie er selbst in den gelehrten Wissenschaften
„die Masse der unzulänglichen Menschen, die einwirken und ihre
Nichtigkeit aneinander auferbauen“, für verderbendrohend ansieht.
In dieser selben Sammlung — eine unentbehrliche Ergänzung zu dem
vorliegenden Briefwechsel — finden wir den ergreifenden Hinweis auf
Schiller: „Schillern war die Christustendenz eingeboren, er
berührte nichts Gemeines, ohne es zu veredeln.“
Die Veredlung! Das ist, was wir in dem Verkehr mit
Goethe und mit Schiller suchen. Das ist ihre lebendige Bedeutung
für unsere kreißende Zeit. Nur in zweiter Reihe interessiert
uns das Literarische, das Historische und das
Ästhetisch-Theoretische, das diese Briefe in so reicher und
anregender Fülle aufgespeichert bewahren. Das alles ist Mittel zum
Zweck; und der Zweck ist: diese zwei großen Persönlichkeiten
in dem folgenschwersten Augenblick ihres Wachsens und Werdens so tief
und so genau wie irgend möglich zu erfassen, auf daß wir
selber, im Innersten bereichert und geläutert, an ihnen emporwachsen.
Houston Stewart Chamberlain
XXIX
XXX
An Seine Majestät den König von Bayern
Allerdurchlauchtigster,
Allergnädigst
regierender König und Herr,
In Bezug auf die von Ew. Königl. Majestät zu meinem
unvergeßlichen Freunde gnädigst gefaßte Neigung
mußte mir gar oft, bei abschließlicher Durchsicht des mit
ihm vieljährig gepflogenen Briefwechsels, die Überzeugung
beigehen: wie sehr demselben das Glück, Ew. Majestät
anzugehören, wäre zu wünschen gewesen. Jetzt da ich nach
beendigter Arbeit von ihm abermals zu scheiden genötigt bin,
beschäftigen mich ganz eigene, jedoch dieser Lage nicht
ungemäße Gedanken.
In Zeiten, wenn uns eine wichtige, auf unser Leben
einflußreiche Person verläßt, pflegen wir auf unser
eigenes Selbst zurückzukehren, gewohnt nur dasjenige schmerzlich
zu empfinden, was wir persönlich für die Folge zu entbehren
haben. In meiner Lage war dies von der größten
Bedeutung: denn mir fehlte nunmehr eine innig vertraute Teilnahme, ich
vermißte eine geistreiche Anregung und was nur einen
löblichen Wetteifer befördern konnte. Dies empfand ich
damals aufs schmerzlichste; aber der Gedanke, wie viel auch er von
Glück und Genuß verloren, drang sich mir
XXXI An Seine Majestät den König von Bayern
erst lebhaft auf, seit ich Ew.
Majestät höchster Gunst und Gnade, Teilnahme und Mitteilung,
Auszeichnung und Bereicherung, wodurch ich frische Anmut über
meine hohen Jahre verbreitet sah, mich zu erfreuen hatte.
Nun ward ich zu dem Gedanken und der Vorstellung
geführt, daß auf Ew. Majestät ausgesprochene
Gesinnungen dieses alles dem Freunde in hohem Maße wiederfahren
wäre; um so erwünschter und förderlicher, als er das
Glück in frischen vermögsamen Jahren hätte
genießen können. Durch allerhöchste Gunst wäre
sein Dasein durchaus erleichtert, häusliche Sorgen entfernt, seine
Umgebung erweitert, derselbe auch wohl in ein heilsameres besseres
Klima versetzt worden, seine Arbeiten hätte man dadurch belebt und
beschleunigt gesehen, dem höchsten Gönner selbst zu
fortwährender Freude, und der Welt zu dauernder Erbauung.
Wäre nun das Leben des Dichters auf diese Weise
Ew. Majestät gewidmet gewesen, so dürfen wohl auch diese
Briefe, die einen wichtigen Teil des strebsamsten Daseins darstellen,
Allerhöchstdenenselben bescheiden vorgelegt werden. Sie geben ein
treues unmittelbares Bild und lassen erfreulich sehen: wie in
Freundschaft und Einigkeit mit manchen untereinander Wohlgesinnten,
besonders auch mit mir, er unablässig gestrebt und gewirkt und,
wenn auch körperlich leidend, im Geistigen doch immer sich gleich
und über alles Gemeine und Mittlere stets erhaben gewesen.
Seien also diese sorgfältig erhaltenen
Erinnerungen hiemit zur rechten Stelle gebracht, in der
Überzeugung, Ew. Majestät werden gegen den
Überbliebenen, sowohl aus eigner höchster Bewegung, als auch
um des abgeschiedenen Freundes willen, die bisher zugewandte Gnade
fernerhin
XXXII An Seine Majestät den König von Bayern
bewahren, damit, wenn es mir
auch nicht verliehen war, in jene ausgebreitete königliche
Tätigkeit eingeordnet mitzuwirken, mir doch das erhebende
Gefühl fortdaure, mit dankbarem Herzen die großen
Unternehmungen segnend, dem Geleisteten und dessen weitausgreifendem
Einfluß nicht fremd geblieben zu sein.
In reinster Verehrung mit unverbrüchlicher
Dankbarkeit lebenswierig verharrend
Weimar, den 18. Oktober 1829
Ew. Königl.
Majestät
alleruntertänigster
Diener
Johann Wolfgang von Goethe
INHALTSÜBERSICHT
Aus dem Jahre 1794
- 13.
Juni 1794, an Goethe
- 24.
Juni 1794, an Schiller
- 25.
Juni 1794, an
Schiller
- 23.
August 1794, an
Goethe
- 27.
August 1794, an
Schiller
- 30.
August 1794, an
Schiller
- 31.
August 1794, an
Goethe
- 04.
September 1794,
an
Schiller
- 07.
September 1794, an
Goethe
- 10.
September 1794, an Schiller
- 12.
September 1794, an Goethe
- 29.
September 1794, an Goethe
- 1.
Oktober 1794, an Schiller
- 1.
Oktober 1794, an Schiller
- 8.
Oktober 1794, an Schiller
- 8.
Oktober 1794, an Goethe
- 17.
Oktober 1794, an Goethe
- 19.
Oktober 1794, an Schiller
- Oktober
1794, an Schiller
- 20.
Oktober 1794, an Goethe
- 26.
Oktober 1794, an Schiller
- 28.
Oktober 1794, an Goethe
- 28.
Oktober 1794, an Schiller
- 1.
November 1794, an Schiller
- 16.
November 1794, an Goethe
- 27.
November 1794, an Schiller
- 29.
November 1794, an Goethe
- 2.
Dezember 1794, an Schiller
- 3.
Dezember 1794, an Goethe
- 5.
Dezember 1794, an Schiller
- 6.
Dezember 1794, an Goethe
- 6.
Dezember 1794, an Schiller
- 9.
Dezember 1794, an Goethe
- 10.
Dezember 1794, an Schiller
- 22.
Dezember 1794, an Goethe
- 23.
Dezember 1794, an Schiller
- 25.
Dezember 1794, an Schiller
Aus dem Jahre 1795
- 2.
Januar 1795, an Goethe
- 3. januar 1795, an
Schiller
- 7. Januar 1795, an
Schiller
- 7. Januar 1795, an
Goethe
- 10. Januar 1795, an
Schiller
- 25. Januar 1795, an
Goethe
- 27. Januar 1795, an
Schiller
- 28. Januar 1795, an
Goethe
- 11. Februar 1795, an
Schiller
- 18. Februar 1795, an
Schiller
- 19. Februar 1795, an
Goethe
- 21. Februar 1795, an
Schiller
- 22. Februar 1795, an
Goethe
- 25. Februar 1795, an
Schiller
- 27. Februar 1795, an
Goethe
- 28. Februar 1795, an
Schiller
- 1. März 1795, an
Goethe
- 8. März 1795, an
Goethe
- 11. März 1795, an
Schiller
- 18. März 1795, an
Schiller
- 19. März 1795, an
Schiller
- 19. März 1795, an
Goethe
- 21. März 1795, an
Schiller
- 25. März 1795, an
Goethe
- 3. Mai 1795, an Schiller
- 4. Mai 1795, an Goethe
- 12. Mai 1795, an
Schiller
- 15. Mai 1795, an Goethe
- 16. Mai 1795, an
Schiller
- 16. Mai 1795, an
Schiller
- 17. Mai 1795, an
Schiller
- 18. Mai 1795, an Goethe
- 18. Mai 1795, an
Schiller
- 21. Mai 1795, an Goethe
- 10. Juni 1795, an
Schiller
- 11. Juni 1795, an
Schiller
- 12. Juni 1795, an Goethe
- 13. Juni 1795, an
Schiller
- 15. Juni 1795, an Goethe
- 18. Juni 1795, an
Schiller
- 19. Juni 1795, an Goethe
- 27. Juni 1795, an
Schiller
- 6. Juli 1795, an Goethe
- 8. Juli 1795, an
Schiller
- 19. Juli 1795, an
Schiller
- 20. Juli 1795, an Goethe
- 29. Juli 1795, an
Schiller
- 11. August 1795, an
Goethe
- 17. August 1795, an
Schiller
- 17. August 1795, an
Goethe
- 17. August 1795, an
Schiller
- 18. August 1795, an
Schiller
- 21. August 1795, an
Schiller
- 22. August 1795, an
Goethe
- 22. August 1795, an
Schiller
- 24. August 1795, an
Schiller
- 29. August 1795, an
Schiller
- 29. August 1795, an
Goethe
- 31. August 1795, an
Goethe
- 3. September 1795, an
Schiller
- 7. September 1795, an
Schiller
- 9. September 1795, an
Goethe
- 13. September 1795, an
Goethe
- 14. September 1795, an
Schiller
- 16. September 1795, an
Schiller
- 18. September 1795, an
Goethe
- 23. September 1795, an
Schiller
- 26. September 1795, an
Schiller
- 2. Oktober 1795, an
Goethe
- 3. Oktober 1795, an
Schiller
- 6. & 10. Oktober 1795,
an
Schiller
- 13. Oktober 1795, an
Schiller
- 16. Oktober 1795, an
Schiller
- 16. Oktober 1795, an
Goethe
- 17. Oktober 1795, an
Schiller
- 19. Oktober 1795, an
Goethe
- 24. Oktober 1795, an
Goethe
- 25. Oktober 1795, an
Schiller
- 26. Oktober 1795, an
Goethe
- 28. Oktober 1795, an
Schiller
- 1. November 1795, an
Goethe
- 1. November 1795, an
Schiller
- 4. November 1795, an
Goethe
- 20. November 1795, an
Goethe
- 21. November 1795, an
Schiller
- 23. November 1795, an
Goethe
- 25. November 1795, an
Schiller
- 29. November 1795, an
Schiller
- 29. November 1795, an
Goethe
- 8. Dezember 1795, an
Goethe
- 9. Dezember 1795, an
Schiller
- 13. Dezember 1795, an
Goethe
- 15. Dezember 1795, an
Schiller
- 17. Dezember 1795, an
Goethe
- 17. Dezember 1795, an
Schiller
- 23. Dezember 1795, an
Goethe
- 23. Dezember 1795, an
Schiller
- 25. Dezember 1795, an
Goethe
- 26. Dezember 1795, an
Schiller
- 29. Dezember 1795, an
Goethe
- 30. Dezember 1795, an
Schiller
- 30. Dezember 1795, an
Goethe
Aus dem Jahre 1796
- 2.
Januar 1796, an Schiller
- 17. Januar 1796, an
Goethe
- 18. Januar 1796, an
Goethe
- 20. Januar 1796, an
Schiller
- 22. Januar 1796, an
Goethe
- 23. Januar 1796, an
Schiller
- 24. Januar 1796, an
Goethe
- 27. Januar 1796, an
Schiller
- 27. Januar 1796, an
Goethe
- 30. Januar 1796, an
Schiller
- 31. Januar 1796, an
Goethe
- 4. Februar 1796, an
Schiller
- 5. Februar 1796, an
Goethe
- 7. Februar 1796, an
Goethe
- 10. Februar 1796, an
Schiller
- 12. Februar 1796, an
Schiller
- 12. Februar 1796, an
Goethe
- 13. Februar 1796, an
Schiller
- Anfang März 1796,
an Goethe
- 18. März 1796, an
Goethe
- 21. April 1796, an
Schiller
- 21. April 1796, an
Goethe
- Anfang Mai 1796, an
Schiller
- 20. Mai 1796, an
Schiller
- Ende Mai 1796, an
Schiller
- 10. Juni 1796, an
Goethe
- 10. Juni 1796, an
Schiller
- 12. Juni 1796, an
Goethe
- 14. Juni 1796, an
Schiller
- 17. Juni 1796, an
Goethe
- 18. Juni 1796, an
Schiller
- 18. Juni 1796, an
Goethe
- 20. Juni 1796, an
Goethe
- 22. Juni 1796, an
Schiller
- 24. Juni 1796, an
Goethe
- 25. Juni 1796, an
Schiller
- 26. Juni 1796, an
Schiller
- 27. Juni 1796, an
Goethe
- 28. Juni 1796, an
Goethe
- 29. Juni 1796, an
Schiller
- 1. Juli 1796, an
Schiller
- 2. Juli 1796, an Goethe
- 3. Juli 1796, an Goethe
- 5. Juli 1796, an Goethe
- 5. Juli 1796, an
Schiller
- 6. Juli 1796, an Goethe
- 7. Juli 1796, an
Schiller
- 8. Juli 1796, an Goethe
- 9. Juli 1796, an
Schiller
- 9. Juli 1796, an
Schiller
- 9. Juli 1796, an Goethe
- 11. Juli 1796, an
Goethe
- 12. Juli 1796, an
Schiller
- 12. Juli 1796, an
Goethe
- 13. Juli 1796, an
Schiller
- 20. Juli 1796, an
Schiller
- 22. Juli 1796, an
Goethe
- 22. Juli 1796, an
Schiller
- 25. Juli 1796, an
Goethe
- 26. Juli 1796, an
Schiller
- 28. Juli 1796, an
Schiller
- 28. Juli 1796, an
Goethe
- 30. Juli 1796, an
Schiller
- 31. Juli 1796, an
Goethe
- 1. August 1796, an
Goethe
- 2. August 1796, an
Schiller
- 5. August 1796, an
Goethe
- 6. August 1796, an
Schiller
- 8. August 1796, an
Goethe
- 10. August 1796, an
Schiller
- 10. August 1796, an
Goethe
- 12. August 1796, an
Goethe
- 13. August 1796, an
Schiller
- 15. August 1796, an
Goethe
- 16. August 1796, an
Schiller
- 17. August 1796, an
Schiller
- 5. Oktober 1796, an
Goethe
- 8. Oktober 1796, an
Schiller
- 9. Oktober 1796, an
Goethe
- 9. Oktober 1796, an
Schiller
- 10. Oktober 1796, an
Goethe
- 10. Oktober 1796, an
Schiller
- 11. Oktober 1796, an
Goethe
- 12. Oktober 1796, an
Schiller
- 12. Oktober 1796, an
Goethe
- 14. Oktober 1796, an
Goethe
- 15. Oktober 1796, an
Schiller
- 16. Oktober 1796, an
Goethe
- 18. Oktober 1796, an
Schiller
- 18. Oktober 1796, an
Goethe
- 19. Oktober 1796, an
Schiller
- 19. Oktober 1796, an
Goethe
- 22. Oktober 1796, an
Schiller
- 23. Oktober 1796, an
Goethe
- 25. Oktober 1796, an
Goethe
- 26. Oktober 1796, an
Schiller
- 28. Oktober 1796, an
Goethe
- 29. Oktober 1796, an
Schiller
- 31. Oktober 1796, an
Goethe
- 2. November 1796, an
Goethe
- 12. November 1796, an
Schiller
- 13. November 1796, an
Goethe
- 14. November 1796, an
Schiller
- 15. November 1796, an
Schiller
- 18. November 1796, an
Goethe
- 19. November 1796, an
Schiller
Letzte
Änderung am 29. Dezember 2025